| |
DER WEG AUS DER
ENGE
In diesem Winter 1986/87 erinnert Mitteleuropa an
Bilder aus dem tiefsten Sibirien:
"Wie der Stahl gehärtet wurde" –
Ostrowskis Epos über den kollektiven Bau einer
Eisenbahnlinie durch die froststarre Taiga.
Ich habe eine verschwommene Erinnerung an diesen
Entwicklungs- und Erziehungsroman aus den
Dreißigern, in den Fünfzigern Pflichtlektüre
in der Karl-Liebknecht-Schule zu Bernsdorf.
Hängengeblieben ist der Eindruck von tödlicher
Kälte, wie sie jetzt in unser Auto kriecht,
durch alle Ritzen, und trotz auf Höchstleistung
laufender Heizung die Innenseiten der Scheiben
mit Frosträn- dern beschlägt.
Es geht schon seit geraumer Zeit bergauf,
zwischen meterhohen Schneewänden, vorbei an
vereinzelten Ferienhäusern und kleinen
Pensionen, die unter Panzern von Eis verborgen
bleiben, ausgewuchert zu Eiszapfen-Palästen. In
engen Kurven sind Lastkraftwagen mit schwerer
Fracht liegen geblieben, schwarzer Gummi hat sich
in schartigen Eismulden abgerieben. Wir ziehen
mit 75 PS und Vorderradantrieb vorbei, und
schaffen es dennoch nicht, vor Einbruch der
Dunkelheit. Die Hinweisschilder sind zugeweht,
wir schlittern in eine hohle Gasse aus Schnee und
Eis, kärglich beleuchtet durch Bogenlampen
hinter Vorhängen von treibenden Flocken.
| Zinnwald,
Staatsgrenze der DDR, Übergang von der
CSSR – ein Mann und eine Frau mit
westdeutschen Reisepässen, die als
Wohnort Harare / Zimbabwe ausweisen,
begehren Einlass. Für den Transit gibt
es eine Laufnummer. Die DDR-Botschaft in
Harare hatte bestätigt, für die
Unterbrechung der Durchreise sei ein
Visum nicht erforderlich – stimmt,
aber nun ergibt sich ein anderes Problem:
Die Laufnummer soll auch das
Herkunftsland der Transitreisenden
vermerken, doch die Buchhaltung des
DDR-Außenministeriums erweist sich als
unzuverlässig. Der abgegriffene Katalog,
der die Länder der Welt durchnummeriert,
registriert unter "Z"
Fehlanzeige.
Ich rege an, unter "S"
nachzuschlagen: Das Bonner Auswärtige
Amt schreibe das afrikanische Land mit
"S" – "Simbabwe"
(und denke an deutsch-deutsche
Gemeinsamkeiten). "Ooch nich,"
sagt die Dame von "Intourist",
und da steigt in mir ein Verdacht auf.
"Vielleicht versuchen Sie es mal
unter 'R' wie Rhodesien," schlage
ich vor.
"Nu ja, da hammers ja!"
Erleichterung, sächsische Bürokratie
kann ihren Lauf nehmen –
nummernmäßig.
|
|
 |
Wir schlittern
bergab Richtung Elbe, durch heimelig erleuchtete
Kurorte. Hinter Schneewehen am Wegesrand lockt
die Wärme eines Cafés. Doch Halten ist
unmöglich: Die Einfahrt ist blockiert durch
Schneemassen. Es wäre Zeit, den Tank
aufzufüllen. Am Ortsausgang Licht in einer
Tankstelle, die Zufahrt blockiert durch
Schneemassen. Will hier keiner ein Geschäft
machen?
Zwei Scheinwerferstrahlen drängen uns an den
Wegrand, ein Militär-LKW donnert vorbei, die
Rücklichter sind bald vom Schneetreiben
verschluckt. Vorsichtig nehmen wir die Fahrt
wieder auf.
Nach zwei Kilometern springt eine winkende
Gestalt in den angestrahlten Schneewirbel.
Dahinter rechts die dunkle Silhouette eines
liegengebliebenen PKW.
"Gönnse uns wohl een Gefalln dun? Mer sin
liechengebliem!" Eiszapfen am Bart, der Atem
gefriert sofort zur Frostwolke.
"Was ist denn das Problem?"
"Nu – die Badderie is alle. Bin schon
zwanzsch Gilomeder runnergeloofen un widder hoch.
Mer missen abgeschlebbd wern."
"Aber war das nicht eben die Volksarmee, die
vorbeigefahren ist?" "Nu – die
helfn doch nich! Däden Se uns wohl den
Gefalln?"
Nach zwanzig Kilometern eine Tankstelle –
ohne Schneeblockade. Eine Hand kommt durchs
geöffnete Fenster.
"Is'n Johannisbeerligör aus der Gechend.
Nehmses als Dangescheen!"
Ankunft im Hotel
"Newa", für die erste Nacht in Dresden
zugewiesen am Grenzkontrollpunkt durch
"Intourist".
"Haben Sie aus Zinnwald eine Reservierung
für uns erhalten?"
"Nee – nich für Sie, bloss für zwee
Leude aus Zimbabwe."
"Ja, das sind wir!"
"Abber, Se sin doch geene Afriganer!"
Die Koffer haben wir selber hereingeschleppt,
jetzt geht es um eine Hotelgarage. Ein
Batterietod in der Frostnacht soll vermieden
werden.
"Mer ham nischt mehr frei!"
Der Hinweis auf 170 Westmark für eine
Übernachtung hilft schließlich weiter, der
Privatwagen eines Hotelangestellten wird aus der
Box der Tiefgarage in die gähnende Leere des
Untergeschosses gerollt. Endlich betreten wir
unser Zimmer im siebten Stock – und gehen
rückwärts wieder raus: Wir haben eine Sauna
gemietet. Eine Etagenkraft des Hotelkaders klärt
uns auf – die auf voller Pulle laufende
Heizung lässt sich leider nicht regulieren. Also
strömt die zentral angelieferte Kraftwerkwärme
durch weitgeöffnete Fenster in die Dresdener
Nacht.
Die lockt zu erster Erkundung.
Nach einigem
Suchen finde ich den Bierkeller am Altmarkt, in
dem ich mit Muttern auf Ausflug vom Dorf in die
Großstadt 1956 Kasseler mit Sauerkraut gegessen
hatte.
Unsere Mäntel werden an der Garderobe gegen zwei
Groschen entgegengenommen. Wir steigen die Treppe
hinab und finden uns am Ende einer Schlange
wieder, die geduldig darauf wartet, dass im
Restaurant der eine oder andere Platz geräumt
wird – das kann Stunden dauern. Jedesmal,
wenn ein Ungeduldiger die Schwingtür öffnet,
tönt es vollkehlig aus dem warmen Säulensaal:
"Es zieht!"
Wir nehmen unsere Mäntel wieder und erklettern
nach weiterem Irren durch menschenleere Straßen
den ersten Stock eines Etablissements, das vor
dreißig Jahren erste Adresse
sozialistisch-kulinarischer Solidarität war: Ein
ungarisches Speiserestaurant.
Hier ist es zwar leer, aber der (deutsche)
Kellner schränkt sofort die Wahlfreiheit ein
– auf einem Podium im hinteren Teil (nahe
der Küche) möchten wir bitte Platz nehmen.
Vier bis fünf Tischbesatzungen beobachten
unseren Widerstand, selber brav auf ihren
vermutlich ebenso angewiesenen Plätzen. Die
ganze Fensterfront ist frei, wir werden zu
Dissidenten – und genießen bei Gulasch und
Rotwein den Blick auf eine einsam rumpelnde
Straßenbahn.
"Laß uns
morgen früh durchfahren bis Bremen," sagt
meine Frau, aber ich will mir die Annäherung an
meine Heimat nicht nehmen lassen (und außerdem
haben wir schon 180 Westmark für die nächste
Übernachtung in Weimar bei "Intourist"
hingeblättert).
| Der
Zwinger ist am nächsten Morgen unser
Ziel, ich will noch einmal die
"Sixtinische Madonna" sehen,
vor der ich atemlos als kleiner Junge
stand. Beinahe hätte ich sie verpasst,
denn ein kleiner dicker Sachse erwischt
uns im Ersten Stock, hat uns fix
ausgemacht als Westler und verwickelt uns
in ideologieträchtige Diskussionen.
"Gorbatschow" ist sein Thema
– und sein rotes Tuch. Verblüfft nehme ich zur
Kenntnis, "dass der Mann erschossn
geheerd". Ich merke bald, das
Weltbild des alten deutschen Kommunisten
ist durcheinandergeraten. "Das gehd
doch bloß uf unsre Gosdn," wettert
er, "nach außn midn Ameriganern
scharwänzln un nach innen fesde
druff!"
Konsequent ist er aus
der Partei ausgetreten und bewacht nun
die alten Meister in Dresdens
Zwinger-Galerie.
|
|
 |
Im Eingang des
"Newa"-Hotels steht bei unserer
Rückkehr plötzlich auch eine Wache, das riesige
Foyer dahinter ist düster und menschenleer. Wo
sind an diesem Tag mitten in der Woche all die
Hotelgäste?
"Nu – mer machn sauber!" sagt der
Wächter und lässt mich ausnahmsweise noch mal
rasch aufs Klo. Der gesamte Geschäftsbetrieb ist
für vierundzwanzig Stunden eingestellt, die
Planwirtschaft holt Atem – koste es, was es
wolle.
43 Kilometer
hinter Dresden radelt ein Bauer am gelben
Hinweisschild vorbei.

"Bernsdorf" – der Name hat sich
nicht geändert, obwohl der Ort inzwischen
Stadtrechte erhielt.
"Zuerst kommt der Bahnhof, dann ein
Wäldchen," will ich erklären, aber da sind
wir schon an ihm vorbei – und das Wäldchen
– noch immer vorhanden – ist auch schon
vorüber. Die Welt ist kleiner geworden, seit ich
als Junge, mit dem Milchtopf in der Hand, die
Strecke zu bewältigen hatte.

Ich bremse, das
Haus meiner Kindheit steht in winterlicher
Nachmittagssonne, gealtert, aber in erinnerter
Kontur zur Linken. Große Mörtelflächen sind
abgefallen – es ist mit mir älter geworden,
denke ich. Mein Blick schweift über die
Nachbarschaft – mein Gott, die Zeit ist
stillgestanden. Verfall ja, aber wenn Altern
Entwicklung meint, dann haben wir beide –
das Haus und ich – sehr unterschiedliche
Erfahrungen gemacht. Als ich aus dem Wagen
steige, trete ich in ein altes, vergilbtes Bild.

Der Hof: Die Tür
zu unserem alten Schuppen steht offen, dort
hinten ist unser Feuerholzplatz, ein
"Scheitlahaufen" wie damals – der
Garten, unverändert. Nein, die Kaninchenställe
von Opa Hayden fehlen, der mir seine Karl
May-Bände lieh und in dessen selbstgebasteltem
Radio wir Kinder Westfunk hörten – illegal
– "Der Onkel Tobias vom RIAS ist
da". Opa Hayden hatte mir die erste
schmerzliche Erfahrung im Umgang mit Geld
vermittelt: Eine geschenkte Banknote mit
unzähligen Nullen, in der Hand des
Sechsjährigen schon eingeplant für die
Anschaffung eines Motorrades, erwies sich als
wertloser Inflationsschein.
Namensschilder an Briefkästen im Treppenhaus.
Ist da noch jemand, den ich kenne? Der Schneider
Panitzek in der Wohnung über uns! Ich ziehe
meinen Handschuh aus, klappe die Ohrenschützer
der etwas zu kleinen Fellmütze zurück –
diese Mütze, eine "Russen"-Mütze,
erst jetzt fällt es mir ein, schenkten mir die
Eltern zu einem Weihnachtsfest in diesem Haus!
Der Mantel, ihn trug mein Vater hier! Beides
wurde zur Ausrüstung des Afrika-Heimkehrers im
deutschen Winter, unbedacht in Bremen
zusammengeklaubt aus Kellerbeständen, weil
Winterkleidung nurmehr für Urlaubswochen nötig
wird.
Es schellt irgendwo hinten in der Wohnung.
"Ja, bitte?" Die ältere Frau, die
geöffnet hat, schaut fragend auf die Fremden.
"Mein Name ist Klaus Jürgen Schmidt
..."
"Die Schmidts wohnen schon lange nicht mehr
hier!"
Aber noch bevor ich die nötige Erläuterung
geben kann, schallt es aus einem der hinteren
Räume: "Der Klausi!"
Das war's! Nun hatte mich die Vergangenheit ganz
eingeholt, nicht nur als Bild, sondern auch
akustisch. "Klausi" – wie ein Echo
meiner Kindheit hallt es durchs Treppenhaus.
Ich kann es kaum kapieren.
Als wäre ich nur mal eben von einem längeren
Ferienaufenthalt zurückgekommen – damals
etwa aus Kühlungsborn an der Ostsee – sitzt
der alte Panitzek gegenüber vom Kachelofen und
fragt mich aus.
"Wo lebt ihr jetzt? In Zimbabwe? – Lass
mal sehen – das ist doch dieser südliche
Teil der ehemaligen Rhodesischen
Föderation!" – Wom!
"Wohnt ihr in Salisbury? Nein – nein,
das heißt doch jetzt Harare!" Womm!
"Ja, ja – euer Premierminister Robert
Mugabe ist bei uns häufig auf dem
Bildschirm!" Wommm!
Also, aus der "Lausitzer Rundschau"
kann der alte Panitzek sein Wissen nicht
ausschließlich bezogen haben, und ich versuche
mir vorzustellen, was wohl ein BRD-Rentner mit
dem Begriff "Zimbabwe" anzufangen
wüsste.

"Ihr mögt ja materiell einen weiten
Vorsprung haben," sagt der alte Panitzek,
"aber unser Bildungswesen, gerade all das,
was die Entwicklungsländer angeht, da sind wir
nicht schlecht versorgt."
Unglücklicherweise hapert es in diesem Winter in
der Dresdener Straße 62 zu Bernsdorf mit der
Wasserversorgung, vor allem im sanitären
Bereich. Wie sehr mich das an die Kindheit
erinnert: Wie in den fünfziger Jahren hat das
Eis die Wasserrohre in den Außenwänden gepackt.
Die Etagen-Plumpsklos sind zwar durch
Wasserspül-Klosetts ersetzt, aber da die
Zuleitungen eingefroren sind und nichts mehr
plumpst, wird das Spülwasser in Eimern auf die
Etagen geschleppt.
"Fortschritt, mein Freund, wird bei uns
unter anderem an der Zahl von Wasserklosetts
gemessen, die seit Gründung der DDR installiert
wurden," sagt mir später ein Bekannter mit
Zugang zu Planungs- und Statistikdaten.
"Wir bauen zum Beispiel auch Waschmaschinen
nach Plan. Dennoch wirst du kaum eine in den
Läden finden. Wie kommt das? Die sozialistische
Planerfüllung funktioniert real so: Der Betrieb
schafft nur 80 Prozent des vorgegebenen Plans
– das ist von Anfang an klar. Die nächst
höhere Ebene, politisch verantwortlich für die
Erfüllung des Solls, meldet dennoch 100 Prozent
Planerfüllung nach Berlin. Auf dem Weg durch die
zentralen Büros verwandelt sich das
Produktionsergebnis auf wundersame Weise
schließlich in eine Übererfüllung des Solls
– sagen wir 120 Prozent. Mit Waschmaschinen
lassen sich dringend benötigte Devisen
erwirtschaften – die tauchen dann im
Versandhandel bei euch im Westen auf. Also wird
ganz oben entschieden: 80 Prozent in den Export,
40 Prozent für den eigenen Markt. Es sind immer
diese 40 Prozent, von denen wir leben!"
Draußen sinkt die
Sonne. Drüben an den Holzbauwerken zieht eine
Diesellok Güterloren vorbei. Im Winter der
Fünfziger pflegte der Mann auf der Dampflok
nachts langsamer zu fahren, damit wir Kinder
hinten auf die Waggons aufspringen und unseren
wartenden Freunden Braunkohlebriketts zuwerfen
konnten – bis einer vom Schäferhund der
Vopo-Wache gebissen wurde.
| Unsere Bande nannte sich
"TIMUR" – nach Arkadi
Gaidars Jungen-Roman "Timur und sein
Trupp". Wir trugen die blauen
Halstücher der Jungen Pioniere –
mit Stolz in jener Zeit von gemeinsamem
Aufbau. Wir sammelten Altpapier, Lumpen,
Eisen, Glas, Knochen und Eicheln in immer
neuen Wettbewerben; der kleine Klaus
hatte auch Opa Haydens Mark Twain-Buch
gelesen, kaufte Mitschülern als
verkappter Tom Sawyer gegen
Pfennigbeträge den Trödel ab und
erschlich sich den begehrten Platz im Bus
zur Rundfahrt durch den Thüringer Wald. Wir organisierten mit
Begeisterung die Kolonnen für den Aushub
der Gräben entlang der Straßenzüge im
Dorf, das Netzwerk erster
Wasserleitungen. Das war Klausis erster
Zugang zum Mediengeschäft: Ein Artikel
im Zentralorgan der "Jungen
Pioniere" – und zehn
Abo-Werbungen, die als
"Selbstverpflichtung" vom
Arbeitseinsatz freistellten. Der
Schneider Panitzek fand damals eine
andere Lösung: Er hatte Sorge um seine
nur Nadel und Faden gewohnten Finger und
kümmerte sich lieber um den Nachschub
voller Bierkrüge von
"Baldermann", den Radeberger
Bierstuben zwei Häuser weiter, als
selbsternannter Zeremonienmeister der
freiwilligen Aufbauschicht.
|
|
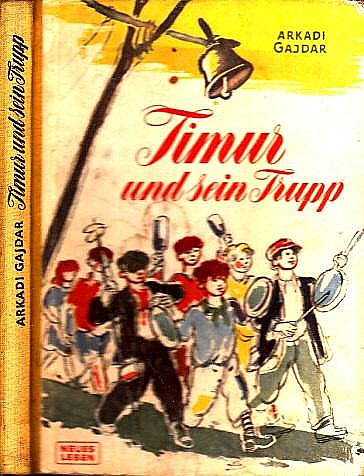 |
Sonntagvormittags
die Botschaften von "Onkel Tobias vom
RIAS" bei Opa Hayden im Radio, nachmittags
am einzigen Schwarz-Weiß-Fernseher des Ortes im
Clubraum der Zinkweißhütte die patriotischen
Botschaften sowjetischer Jugendfilme.
In einem Winter wie diesem lauern fünf Jungen
und zwei Mädchen hinter der Gartenmauer bei Oma
Lehmann. Endlich meldet der Ausguck: "Die
Luft ist rein!"
Oma Lehmann zieht mit dem Schlitten zum KONSUM.
Sieben Kinder mit blauen Halstüchern stürzen
auf ihren Hof. Eine Stunde später ist der
vormittags angelieferte Berg Braunkohle durch das
Kellerfenster geschaufelt, mit dem letzten Stück
malt Klausi fünf Buchstaben an die Mauer: TIMUR,
und dann wartet die Bande im Versteck auf die
Rückkehr von Oma Lehmann. Die kriegt fast einen
Herzschlag, als sie den leeren Hof betritt.
Sieben Kinder mit glühenden Wangen schultern
ihre Schaufeln und schleichen von dannen.
Im Abfall der
Holzbauwerke, sorgfältig für Küchenherd und
Kachelofen das Jahr über auf dem Holzhackplatz
gestapelt, findet Klausi in einem Sommer ein
Stück, das sich mit Hilfe eines Schnitzmessers
bald in die Form eines Gewehres verwandelt.
Zwischen Bohnen- und Tomatenranken wird mal
"Old Shatterhand", mal
"Rotgardist" gespielt – bis sich
im Zweiten Stock ein Fenster öffnet.
"Ihr Lausejungen! – Haben euch eure
Eltern nichts besseres beigebracht?"
Die sonst so stille Nachbarin, die sich an
Hausfesten nie beteiligt, an der sich im
Treppenflur die anderen Bewohner scheu
vorbeidrücken – sie schreit sich jetzt die
Lunge aus dem Leib.
"Die Hand soll euch verdorren, wenn ihr noch
mal ein Gewehr anfasst!"
Aber es ist doch nur ein Stück Holz, denkt der
kleine Junge und beschwert sich abends bei
Vatern.
"Die Zeilern soll sich bei ihren
Kommunistenfreunden beschweren, d i e laufen doch
schon wieder mit der Knarre 'rum," bekommt
der Junge zu hören.
"Aber sie war doch im Lager,"
beschwichtigt Muttern.
Im Lager?
Aus Siegfried Körners Bernsdorf-Chronik:Den Räumungsbefehl für die
Bernsdorfer Einwohner gaben am 19. April
1945 der Ortsgruppenleiter der NSDAP,
Otto Hoffmann, und die
Ortspolizeibehörde. Die Alarmierung
erfolgte um 19.30 Uhr durch die Sirene.
... Der Abmarsch erfolgte gegen 22.00
Uhr. Als Evakuierungsorte waren Radeburg
und Dippoldiswalde vorgegeben. Die
Mehrzahl der Bernsdorfer Einwohner, die
der faschistischen Propaganda
"Bolschewismus bedeutet Tod"
vertrauten, floh in Richtung Dresden,
Kamenz und in die umliegenden Wälder.
...
Meine Mutter, meine
Schwester und ich im Kinderwagen, waren
dabei.
|
|
eigener
Postkartenfund: "Adolf-Hitler-Straße"
in Bernsdorf, Ansicht 1936

|
Einige Monate
später gehen alle Klassen der
Karl-Liebknecht-Schule geschlossen zu einer
Nachmittagsvorstellung ins Dorfkino. Danach kann
Klausi nächtelang nicht schlafen. Die Eltern
beschweren sich beim Schulleiter – eine
Zumutung für die Kinder! Der kleine Junge hat
Berge von Leichen zu sehen bekommen,
Verbrennungsöfen, ausgemergelte Überlebende des
Konzentrationslagers von Auschwitz. Zu Hause wird
darüber nicht gesprochen. Aber Klausi sieht nun
die Zeilern mit anderen Augen, und irgendwann hat
er ihr heimlich einen Schuhkarton mit Tomaten und
Bohnen vor die Tür gestellt.
Wenig später fehlt eines Montagmorgens der
Schulleiter beim Fahnenappell. "Seid bereit
– immer bereit!" grüßen die Schüler,
nur wenige tragen keine blauen Halstücher. Dann
geht das Gerücht um: "Der ist weggemacht!
Nach'm Westen!"
Es wird schick, keine blauen Halstücher mehr zu
tragen. Bald gibt es zwei Gruppen in der
Dorfjugend – die eine, die weiter zum
Konfirmandenunterricht geht, die andere, die sich
auf die Jugendweihe vorbereitet. Im Winter tragen
beide Gruppen heftige Schneeballschlachten aus,
der Widerborst wird schließlich in den
Schulunterricht getragen.

Künanz weigert
sich eines Tages, ein Gedicht von Heinrich Heine
vorzutragen, das er "gottlos" nennt. Es
gibt Tränen und einen Kinderaufstand. Eine
Delegation rennt aus dem Schulgebäude, es soll
Beschwerde geführt werden beim Dorfpastor.
Klausi ist dabei – Künanz ist sein Freund,
und seit geraumer Zeit gehört er auch zu den
Konfirmanden.
Der Pastor macht nicht auf. Durchs Fenster
informieren ihn die aufgeregten Jungen und
Mädchen über den "Gottesfrevel", der
Geistliche wird blass und schließt das Fenster.
Am nächsten Sonntagmorgen ist die Kanzel leer
– am Nachmittag weiß es jeder im Dorf: Der
Pastor ist weggemacht.
Eines Tages sind
die wilden Tiere im Dorf, ein Löwe, ein Elefant,
ein Dromedar. Im Luna-Park wächst das
Viermastzelt des Zirkus MOCK, und Klausi
schwänzt den Unterricht. Mit einer vom Vater
geklauten alten Hose schmeichelt er sich bei den
Stalljungen ein und darf die Tiere füttern. Die
Meldung über das tagelange Schwänzen bei den
Eltern durch den Klassenlehrer verhindert den
Aufbruch in die große, weite Welt. Der erfolgt
zwei Jahre später, als die Familie – dem
Vater folgend – wegmacht, nach Bremen.
Klausi kannte die Hafenstadt von alten
Postkarten, lieber wäre er nach Hamburg
weggemacht, dem "Tor zur Welt". Aber
– so lernte er in späteren Jahren von den
Bremern – "Die Hamburger haben bloß
das Tor im Wappen, wir haben den Schlüssel
dazu!" Es brauchte seine Zeit, bis der
große Klaus den Sinn begriff, in Stein gehauen
über dem Eingang des Bremer Schütting:
"Buten un binnen – wagen un
winnen!" – das Verständnis von
Krämern mit einem Hang zum finanziellen Risiko
und der Erwartung, dabei schon einen Reibach zu
machen. Egal, wie weit entfernt von der Heimat,
egal auch, ob per Brieftaube oder Satellit.

Es war zehn Uhr
morgens in Weimar als das Foto entstand: Das
Ehepaar Schmidt aus Zimbabwe im Schnee vor Goethe
und Schiller auf hohem Sockel, die Morgensonne
kaum sichtbar hinter einem Dunstschleier –
ich rieche diese Wintermorgenluft von Weimar,
Braunkohlenrauch aus den Kaminen. Der vertraute
Geruch der Kindheit. Klausi beginnt zu träumen.
...
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
Beim
Weihnachtsfest im Betrieb des Vaters hat er zwei
Bücher geschenkt bekommen mit Fotos von einer
Afrika-Safari des Dresdener Zoo-Direktors:
Giraffen, Löwen, Elefanten – und mit
Bildern von fremden Menschen, Massai in Kenia.
Die Reste von "TIMUR" bauen am Waldsee
ein Floß, Unterstände aus Reisig und Laub
werden zu afrikanischen Hütten. Klausi trifft
Künanz im Busch.
"Dr. Livingstone – I presume?"
– sehr falsch ausgesprochen, Englisch steht
nicht auf dem Lehrplan der
Karl-Liebknecht-Schule, dafür Russisch. Am
Dorfrand gibt es das "Russenlager",
eine abgeschirmte Baracken-Kaserne für Soldaten
der "Roten Armee". Von denen dürfen
nur Offiziere raus. Mit einem machte ich ungute
Bekanntschaft.
Vom Erkerfenster
unserer Wohnung gegenüber den Holzbauwerken an
der Dresdener Straße hatte ich in einem der
Allee-Bäume ein von Ast zu Ast hüpfendes
Eichhörnchen beobachtet. Dann passierte alles
auf einmal – ich hörte einen lauten Knall
und sah das Eichhörnchen auf die Straße
stürzen. Als ich atemlos unten ankam, hielt es
ein Mann am Schwanz mit einer Hand in die Höhe,
während er mit der anderen eine Pistole in sein
Gürtel-Holster schob.
Ein russischer Offizier erklärte dem sprachlosen
Schüler: 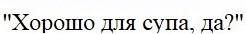 – "Gut für die Suppe,
ja?" – "Gut für die Suppe,
ja?"
Wenn wir mit einem
Pionier-Wimpel vorweg das Russenlager besuchen
mussten, gab es dort selten etwas zu Essen, aber
in verschwiegenen Ecken für mutige Pioniere
schon mal einen Wodka oder ein Tütchen
"Machorka". Als mein Vater das einmal
mitbekam, nannte er den Tabak verächtlich
"Stalinhäcksel". Nicht mit bekam er,
dass ich mir dafür gelegentlich seine
Ulmer-Pfeife auslieh. ...
Aber Klausi musste
lernen, dass es bald keine Friedenspfeifen mehr
waren, die wir heimlich rauchten, dass mehr und
mehr verloren ging von dem, was er bei
gemeinsamen TIMUR-Aktionen meinte, verstanden zu
haben: sich um Bedürftige zu kümmern, egal
woher sie kommen.

Dieses Foto stammt aus einem Buch, das mir ein
fleißiger Bernsdorfer Geschichtsforscher vor ein
paar Jahren zuschickte, als Dank für eines
meiner Fotos, das bei der Winterreise 1986/87
entstanden war. Es zeigt den an ein Hotel
angelehnten "Gerichtskretscham". Das
Wort "Kretscham", ist entlehnt aus dem
(rekonstruierten) altsorbischen Wort
"*krc’ma" = "Schenke, Kneipe,
Krug" und aus der Oberlausitzer Mundart
"Kraatschn". Bezeichnet wurde damit ein
Dorfgasthaus bzw. eine Schänke, die häufig Sitz
des mit der Schankgerechtigkeit bedachten
Schultheißen und Ort des Dorfgerichts war.
Sorbisch war zu meiner Schulzeit in Bernsdorf
eine angesehene Kultursprache. In der
Karl-Liebknecht-Schule war das Klassenbuch jedes
Schülers zweisprachig, und auf dem Dorfschild
– oben nicht gut zu
erkennen – war unter Bernsdorf amtlich
dessen sorbischer Name "Njedzichow"
vermerkt.
Es war kein Sorbe,
der mir in dem morschen Fachwerkbau den Horizont
weitete – über das
hinaus, was ich mir bis dahin von Karl May, von
B. Traven und von Jack London angelesen hatte. Er
kam aus der "Rumänen-Siedlung"
Geflüchteter hinter den Bahngleisen, und er
hatte einen Klumpfuß, der in einem prachtvoll
geformten Lederschuh steckte. Außerdem hatte er
ein ziemlich dunkles Gesicht und viele schwarze
Locken.
Ich glaube, ihm waren gerade Stapel alter
Zeitungen aus den Armen gefallen. Ich half ihm,
sie über eine Holzstiege hinauf in den ersten
Stock zu tragen. Dort, so begriff ich rasch, war
er dabei, sich eine Werkstatt einzurichten, eine
Schusterwerkstatt. Es gab keinen Strom und keine
Heizung. Ich lernte von ihm, wie zwischen
einfachen Holzgittern festgestopfte
Zeitungsknäuel beste Wärmeisolierung schafften.
Ich lernte von ihm, wie toll eingemachte grüne
Tomaten schmeckten. Ich lernte von ihm, wie sich
Menschen ganz unterschiedlicher Herkunft
prächtig verstehen können. ...
Eines Nachmittags hörten wir von unten das
hässliche Gejohle von jenen Jungs, die noch nie
an TIMUR-Aktionen oder an Friedenspfeifen
geglaubt hatten. Sie schafften es, uns Angst zu
machen.
In der mir
zugesandten "Geschichte der
Industriegemeinde/-stadt Bernsdorf (Oberlausitz)
von 1945 bis 1990" erfuhr ich, dass dieser
alte Gerichtskretscham aus dem Jahr 1794 –
in dem ich als kleiner Junge erstmals eine andere
Kultur als die militärisch-russische
kennengelernt hatte – auf
Beschluss der Gemeindevertretung abgerissen
worden war, "um das kulturelle Leben in
der Gemeinde Bernsdorf zu verbessern".
Im kalten Wohnhaus
Goethes steht an prominenter Stelle eine Vitrine
mit Handschriften des Dichters. Eine kundige Hand
hat ins Zentrum dieser Vitrine eine Botschaft des
Napoleon-Bewunderers und Italien-Reisenden
gerückt, die zu überprüfen ist:
"... Und wie wir auch in ferne Lande
ziehn / da kommt es her, da kehrt es wieder hin.
/ Wir wenden uns, wie auch die Welt entzücke /
der Enge zu, die uns allein beglücke..."
Die Zeiten haben
sich geändert, Herr Geheimrat!
"Der
Kellner des Gasthofes 'Zum Elephanten' in Weimar,
Mager, ein gebildeter Mann, hatte an einem
sommerlichen Tage ziemlich tief im September des
Jahres 1816 ein bewegendes, freudig verwirrendes
Erlebnis."

So beginnt Thomas
Mann seinen Roman "Lotte in Weimar".
Der Gasthof ist heute ein superteures
Inter-Hotel, und das Erlebnis zweier Reisender
aus Zimbabwe im Winter 1986/87, die zu später
Stunde nach stressiger Fahrt über spiegelglatte
Straßen im "Elephanten" eintreffen ist
eher frustrierend: Obwohl das Keller-Restaurant
noch geöffnet und die Küchenbesatzung noch
anwesend ist, wird den Hungrigen ein Mahl
verweigert. Der Kellner versucht verlegen zu
erklären, dass nach Auffassung des
Küchen-Kaders die Zubereitung einer warmen
Mahlzeit das Ende der Dienstzeit überschreiten
würde: Es gibt Bockwurst mit Senf und einigen
Scheiben trockenen Brotes. Danach schleppen die
Reisenden ihre Koffer eigenhändig vom Auto ins
Hotel. Der Türsteher, gebeten, behilflich zu
sein, hatte korrekt festgestellt:
"Viel zu gald!"
Ach, lieber Thomas
Mann:
"Die Damen standen noch, dem Hause
abgekehrt, bei dem Postwagen, die Niederholung
ihres übrigens bescheidenen Gepäcks zu
überwachen, und Mager wartete den Augenblick ab,
wo sie, beruhigt über ihr Eigentum, sich gegen
den Eingang wandten, um ihnen sodann, ganz
Diplomat ... auf dem Bürgersteig
entgegenzukommen."
In der
winterkalten Hotelhalle am nächsten Morgen kommt
Johann Wolfgang von Goethes Postulat ins Wanken:
Die Enge beglückt nicht mehr.
Der Freund, der uns abholt, hört sich die
sentimentale Schilderung von der Annäherung an
die Heimat an, denkt nach und sagt:
"Das ist der Charme, den wir zu bieten
haben: Stillstand! Unsere Dörfer, unsere Städte
– Stillstand! Ihr kommt her und findet ein
verwittertes Museum, aber die Menschen, die darin
leben müssen, wollen raus!"
Später lernen wir s e i n e DDR-Nische kennen:
Ein umgebautes Bauernhaus mit Apfelbaum-Garten,
Kamin innen und außen, ein Swimmingpool, ein
Maler-Atelier. Dorthin zieht der Facharzt sich
zurück, wenn er von der Arbeit kommt. An diesem
Nachmittag kommt seine Frau zum letzten Mal von
ihrer Arbeit heim, vom Lehramt an der
Universität – sie ist suspendiert. Beide
haben einen Antrag zur Ausreise aus der DDR
gestellt, wollen ganz von vorne anfangen –
warum?
"Will ich mit meiner Forschung weiterkommen,
brauche ich internationale Kontakte mit Kollegen,
auch bei Fachkonferenzen im Westen. Ich darf
nicht reisen – ich bin nicht in der
Partei."
Der Freund zeigt auf die Wände voller Bilder.
"Ich will nach Paris fahren können, den
Louvre sehen, nach Florenz – ich verkümmere
hier. Mein Gott, ich will noch etwas sehen von
der Welt!"

Es ist schon Nacht
als wir Richtung Magdeburg fahren. Der Vollmond
schiebt sich über den Horizont und beleuchtet
eine bizarre Schnee- und Eislandschaft, nur
Kerzenlicht hinter den Fenstern in den Dörfern
– Stromsperre in weiten Teilen der DDR. In
drei Jahrzehnten haben es die sozialistischen
Staatsplaner nicht vermocht, die Abhängigkeit
von dem einen Energieträger zu verringern.
Im Autoradio hören wir Berichte von der
Braunkohlenfront, Soldaten der Volksarmee sind im
Einsatz, um die gefrorene Kohle von den Halden
auf Eisenbahnwaggons zu laden.
Kurz vor
Mitternacht treffen wir in Helmstedt ein, erste
Anlaufstelle für Bürger der DDR, die –
knapp drei Jahrzehnte nach dem Aufbruch der
Schmidts aus Bernsdorf – noch immer
wegmachen.
Zwei Jahre später
werden wir zusammen mit unserer Tochter Verwandte
besuchen, die aus der Bundesrepublik wegmachten
– als Auswanderer nach Australien, auf der
Flucht vor politischer und militärischer
Unsicherheit in Mitteleuropa!
In der Sylvesternacht 1988/89 hören die Schmidts
und ihre Verwandten bei einer
Live-Fernsehübertragung vor dem Rathaus zu
Brisbane als erstes Lied im neuen Jahr John
Lennons' "Imagine".
In diesem Jahr
1989 verändert sich die Welt in Europa
unvorstellbar. In der Nacht vom 9. zum 10.
November erlebt die Tochter in Berlin die
Öffnung der Mauer. Ihren Eltern schickt sie in
einem Brief nach Harare ein selbst
herausgehauenes, kleines Mauerstück. Am Anfang
ihres Architekturstudiums stand der Abbruch einer
Mauer – und die Lektion: Um etwas neues zu
bauen, müssen oft alte Mauern eingerissen
werden.
|